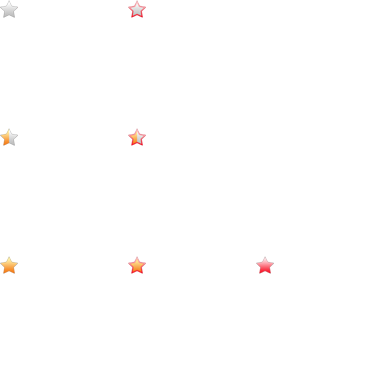In § 9 Abs. 2 Satz 1 des Brandenburgischen Polizeigesetzes (BbgPolG) ist geregelt, dass Polizeivollzugsbedienstete bei Amtshandlungen an ihrer Dienstkleidung ein Namensschild tragen. Das Namensschild wird nach § 9 Abs. 2 Satz 2 BbgPolG beim Einsatz geschlossener Einheiten durch eine zur nachträglichen Identitätsfeststellung geeignete Kennzeichnung ersetzt. § 9 Abs. 3 BbgPolG sieht eine Ausnahme von der Legitimationspflicht und der namentlichen Kennzeichnung vor, soweit der Zweck der Maßnahme oder Amtshandlung oder überwiegende schutzwürdige Belange des Polizeivollzugsbediensteten dadurch beeinträchtigt werden. Die auf Grundlage der Ermächtigung in § 9 Abs. 4 BbgPolG erlassene, die Kennzeichnungspflicht betreffende Verwaltungsvorschrift (VV Kennzeichnungspflicht) sieht die Befreiung einiger im Einzelnen aufgeführten Einheiten vor. Die Beschwerdeführerin steht als Polizeihauptkommissarin im Dienst des Landes Brandenburg. Ihr im Frühjahr 2013 gestellter Antrag auf Befreiung von der Kennzeichnungspflicht wurde vom Polizeipräsidium abgelehnt und ein hiergegen eingelegter Widerspruch zurückgewiesen. Die gegen Ausgangs- und Widerspruchsbescheid gerichtete Klage blieb vor dem Verwaltungsgericht Potsdam ebenso erfolglos wie ihre Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg und ihre Revision vor dem Bundesverwaltungsgericht. Mit ihrer Verfassungsbeschwerde rügt die Beschwerdeführerin eine Verletzung ihres Rechts auf informationelle Selbstbestimmung aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG). Zudem genüge die angegriffene Regelung insgesamt nicht dem Gesetzesvorbehalt und dem Bestimmtheitsgebot (Art. 20 Abs. 1 und Abs. 3 GG).
Die Verfassungsbeschwerde ist unzulässig, denn sie ist nicht hinreichend substantiiert begründet. Soweit die Beschwerdeführerin darauf abstellt, dass sich das durch die Kennzeichnungspflicht verursachte Gefahrenpotential für Polizeivollzugsbedienstete erst im Nachhinein (zum Beispiel durch eine Internetrecherche) realisiere und die Ausnahmeregelung in Ziffer 4.3 VV Kennzeichnungspflicht deshalb unzureichend sei, ist ihr zwar zuzugestehen, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Namen betroffener Polizeivollzugsbediensteter erst einige Zeit nach der Vornahme der Amtshandlung „gegoogelt“ oder anderweitig recherchiert werden. Die Beschwerdeführerin lässt allerdings offen, inwieweit die Kenntnis des Nachnamens Zugang zu Daten liefern kann, die es erlauben, ein viel weitergehendes Persönlichkeitsbild von Polizeibediensteten und/oder dritten Personen zu ermitteln. Sie bleibt in der Beschreibung des Risikos, welchem sie sich durch die namentliche Kennzeichnungspflicht ausgesetzt sieht, pauschal. Hinsichtlich der Folgen eines späteren Datenabrufs setzt sie sich insbesondere nicht mit der Frage auseinander, inwieweit sich hier eine Gefahr realisiert, die über das Risiko hinausgeht, dem sämtliche Beamtinnen und Beamte ausgesetzt sind, die unter Nennung ihres Namens Amtshandlungen vornehmen. Soweit die Beschwerdeführerin Zweifel an den tatsächlichen Feststellungen des Bundesverwaltungsgerichts zur Zunahme von Angriffen auf Polizeivollzugsbedienstete nach Einführung der Kennzeichnungspflicht äußert, übergeht sie die Bindung des Bundesverwaltungsgerichts an die tatsächlichen Feststellungen des Oberverwaltungsgerichts (§ 137 Abs. 2 VwGO). Ihr weiterer Vortrag zur zunehmenden Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten bleibt unsubstantiiert, weil sie sich nicht mit vorhandenen Statistiken und Erkenntnissen zur Kennzeichnungspflicht befasst. Soweit die Beschwerdeführerin die namentliche Kennzeichnungspflicht als unverhältnismäßig im engeren Sinne rügt, weil damit nur unzureichende Vorkehrungen zum Schutz der Polizeivollzugsbediensteten seitens des Dienstherrn getroffen worden seien, hätte sie sich näher mit den Möglichkeiten auseinander müssen, ihre Daten durch eine Auskunftssperre im Melderegister oder durch Nutzung der Privatsphäreeinstellungen in sozialen Netzwerken selbst wirksam zu schützen.
Soweit sie rügt, dass mit der Verpflichtung zum Tragen eines Dienstnummernschildes ein milderes Mittel im Vergleich zum Tragen eines Namensschildes zur Verfügung stehe, blendet sie aus, dass durch die namentliche Kennzeichnungspflicht auch die Bürgernähe der Polizei gefördert werden soll. Sie setzt sich nicht damit auseinander, dass mit einer bloßen Nummer oder anderweitigen Kennzeichnung dieses weitere Ziel der Regelung ersichtlich nicht in gleicher Weise erreicht werden kann. Auch soweit die Beschwerdeführerin einen Verstoß gegen den Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit, insbesondere der Normenklarheit und Bestimmtheit rügt, macht sie die Möglichkeit einer Grundrechtsverletzung nicht deutlich. Sie trägt vor, die Regelung sei unbestimmt, weil die Ausnahmen von der Kennzeichnungspflicht weder durch den parlamentarischen Gesetzgeber noch sonst mittels gesetzlicher Regelung, sondern durch eine Verwaltungsvorschrift bestimmt worden seien. Soweit sie meint, dass § 9 Abs. 4 BbgPolG bei der Annahme des Bundesverwaltungsgerichts, wonach Ziffer 4.3 VV Kennzeichnungspflicht nur den Wortlaut von § 9 Abs. 3 BbgPolG wiederhole und die Ausnahmeregelung erläutere, materiell-rechtlich ins Leere laufe, setzt sie sich nicht damit auseinander, dass die Norm unter anderem bezogen auf die Ausgestaltung der Ausnahmen einen Regelungsgehalt aufweist. Auch befasst sie sich nicht mit der Frage, ob sich jegliche Konkretisierung der Kennzeichnungspflicht etwa in Bezug auf spezielle Polizeieinheiten auf der Ebene des Gesetzes überhaupt sinnvoll vornehmen ließe. Die Verfassungsbeschwerde ist auch unzulässig, soweit sie sich mittelbar gegen § 9 Abs. 2 bis 4 BbgPolG und die VV Kennzeichnungspflicht wendet, da sie keinen gesonderten Vortrag zur mittelbaren Rechtssatzverfassungsbeschwerde enthält.
Dokument-Nr. 32406